| Tag
für Tag stimmen die Kantons- und Bundesbehörden,
die Krankenkassen und ein Teil der Ärzte
dasselbe Klagelied an: „Die Gesundheitskosten
explodieren, das können wir uns nicht mehr
leisten.“
Was steckt hinter diesem Geschwätz? Die
Graphik 1 stellt die Aufteilung der „Kosten
des Gesundheitswesens“ auf die Anbieter
von Leistungen und Gütern dar.
Die insgesamt 51,6 Milliarden Franken im Jahr
2004 verteilten sich folgendermassen:
 Spitäler: 18,2 Milliarden
Spitäler: 18,2 Milliarden
 Soziale Einrichtungen und Pflegeheime (für
betagte Personen, Behinderte, Drogenabhängige,
usw.): 9,3 Milliarden
Soziale Einrichtungen und Pflegeheime (für
betagte Personen, Behinderte, Drogenabhängige,
usw.): 9,3 Milliarden
 ambulante Behandlungen: 15,5 Milliarden,
davon 8,8 für die Ärzte
ambulante Behandlungen: 15,5 Milliarden,
davon 8,8 für die Ärzte
 Detailhandel: 4,9 Milliarden, davon 3,5 für
die Apotheken
Detailhandel: 4,9 Milliarden, davon 3,5 für
die Apotheken
 Ausgaben des Staates (Verwaltung, Prä-vention)
und der Krankenkassen (Verwaltung, Amortisation):
3,2 Milliarden.
Ausgaben des Staates (Verwaltung, Prä-vention)
und der Krankenkassen (Verwaltung, Amortisation):
3,2 Milliarden.
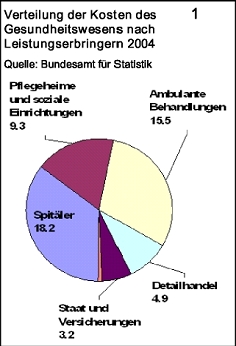
Unablässig
wird wiederholt, dass diese Kosten 11,5% des
Bruttoinlandprodukts (BIP) im Jahr 2004 entsprechen.
Das ist die magische Prozentzahl des BIP, welche
die Schweiz weltweit auf dem zweiten Rang hinter
den USA platziert. Alle unsozialen Massnahmen
im Namen des „Erhalts der Wettbewerbsfähigkeit
der Schweiz“ werden dadurch gerechtfertigt
die bevorstehenden Massnahmen im Gesundheitsbereich).
Trügerische
Vergleiche
Der Vergleich der Gesundheitskosten geht von
unterschiedlichen Situationen aus und täuscht
deshalb in mehrfacher Hinsicht. Ein Beispiel:
In der Schweiz werden die langfristigen Ausgaben
für betagte Menschen und chronische Krankheiten
zu den Gesundheitskosten gezählt. In den
nordischen Ländern ist das nicht der Fall.
Die Gesundheitsausgaben liegen in Dänemark
bei 8,9%, in Schweden bei 9,1% und in Norwegen
bei 9,7% des BIP.
Im Jahr 2004 (Bezugsjahr für alle hier
genannten Zahlen) lagen aber diese langfristigen
Pflegekosten in der Schweiz bei 6,4 Milliarden,
was etwa 1,4% des BIP entspricht.
Wird nur schon diese Zahl berücksichtigt,
schrumpft der Unterschied bei den Gsundheitsausgaben
zwischen der Schweiz und Schweden oder Norwegen
beträchtlich zusammen. Die (sehr oft trügerischen)
internationalen Vergleiche beeindrucken und
lähmen das kritische Denken. Die herrschenden
Klassen aller Länder nutzen dies systematisch
aus.
Vergessen
und täuschen
Die Ausgaben für die Wohnungsmieten sind
in der Schweiz deutlich höher als im europäischen
Durchschnitt. Den Banken, Versicherungen, Immobilienfirmen,
Hauseigentümern und übrigen Parasiten
der Bodenrente kommt es dennoch nicht in den
Sinn, eine tagtägliche Kampagne gegen die
Kostenexplosion der Mieten für die Mehrheit
der Bevölkerung zu führen. Sie verlangen
nicht, dass die Mieten gesenkt werden. Tatsächlich
liegt beinahe die ganze Last der Mieten auf
den Schultern der Mieter und Familien. Dieses
Ziel streben die bürgerlichen Parteien,
die Versicherungen und die Unternehmen auch
im Ge sundheitsbereich an.
Die Gegner der sozialen Einheitskasse aus dem
politischen und wirtschaftlichen Lager tragen
ohne Ende ihre Weisheiten zur Kostenexplosion
vor. Warum? Weil sie Änderungen einführen
wollen, die einerseits einen grösseren
Anteil der Gesundheitskosten auf die Haushalte
abwälzen und anderseits die Leistungen
für zahlungskräftige Kunden ausbauen
und rentabler gestalten. Auch wenn dies dazu
führt, dass ein Teil der Bevölkerung
den Gürtel noch enger schnallen muss. Die
Krankenkassen und ihre Verbündeten (Privatkliniken,
usw.) wollen aus den verfügbaren Mitteln
der Bevölkerung noch mehr Profit schöpfen,
so wie es die Hauseigentümer auch tun.
Wer
trägt die Kosten?
Wenn die Kosten unerträglich sind, dann
sind sie es für die Haushalte, das heisst
für die meisten lohnabhängigen Familien.
Denn in kaum einem anderen Land finanzieren
die Lohnabhängigen einen so grossen Anteil
der Gesundheitskosten wie in der Schweiz: 67%
(siehe Graphik 2). Dafür gibt es vier Gründe:
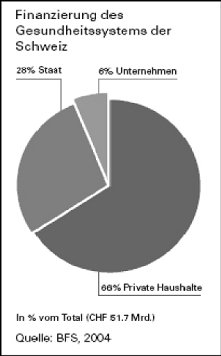
1. Ganze Bereiche werden durch
die obligatorische Krankenversicherung nicht
gedeckt: zum Beispiel die Zahnarztkosten. Das
führt zu einer Situation, in der man sich
den Zahnarzt nur leistet, wenn alles Wichtige
bereits bezahlt ist.
Die Aufenthalte in sozialen und Pflegeheimen
sind schlecht versichert. Zahlreiche Medikamente
werden nicht bezahlt, und deren Preis liegt
erst noch weit über dem europäischen
Durchschnitt.
Im Jahr 2004 erreichten die direkt durch die
Haushalte bezahlten Gesundheitsausgaben, die
von den Krankenkassen nicht beglichen werden,
13,6 Milliarden Franken. Hier spricht aber niemand
von Kostenexplosion.
2. Hinzu kommen die Franchisen
und Kostenbeteiligungen, wie sie im KVG vorgesehen
sind: 2,8 Milliarden Franken im Jahr 2004, Tendenz
steigend.
3. Das Kopfprämiensystem
(individuelle Prämie für Erwachsene
und Kinder, unabhängig vom Einkommen) führt
dazu, dass die Haushalte unter der Last der
Krankenversicherung leiden: 18,9 Milliarden
Franken im Jahr 2004, davon 14,4 für die
Grundversicherung.
In den anderen europäischen Ländern
wird die Krankenversicherung meistens durch
einkommensabhängige Lohnabzüge (zur
Hälfte durch die Unternehmen) finanziert,
und/oder durch Steuern.
Auch in dieser Hinsicht spricht das helvetische
Establishment nicht von einer unerträglichen
Belastung. Das stimmt natürlich auch -
für die Eliten selbst.
Ausserdem wird alles Mögliche getan, um
jedes Gefühl von Gleichheit zu unterdrükken.
Dieses Gefühl könnte auf zwei Formeln
gebracht werden. Erstens: „Es ist normal,
bei einer obligatorischen Versicherung einen
Beitrag zu bezahlen, der vom Einkommen oder
von den verfügbaren Mitteln des Haushalts
abhängig ist.“ Zweitens: „Ich
verdiene vielleicht weniger als mein Chef oder
als ein Regierungsrat, aber ich möchte
nicht medizinisch schlechter versorgt werden
als diese Personen.“
Die ganze Kampagne der Individualisierung der
Prämien, deren Vervielfachung (70'000 verschiedene
Prämien in der Schweiz!) und der Mythos
des Patienten als einem Kunden, dem es gelingt,
die beste Prämie und Franchise herauszufinden,
indem er ohne Ende die Angebote der Krankenkassen
vergleicht, dienen der Zerstörung jeder
solidarischen Haltung und des Widerstands gegen
die Kommerzialisierung des Gesundheitsbereichs.
4. Seit den 1970er Jahren wurde
der Anteil der Steuern an der Finanzierung der
Gesundheitsausgaben deutlich gesenkt: von 39,5%
im Jahr 1972 auf 27,3% im Jahr 2004. Sogar das
Bundesamt für Statistik muss anerkennen,
dass der Staatsanteil am Ende der 1990er Jahre
bei einem historischen Minimum liegt. Ausserdem
ist zu bedenken, dass die direkten Steuern bei
den höchsten Einkommen nicht mehr progressiv
sind und Vermögen kaum erfassen.
All dies führt zu folgender Schlussfolgerung:
Wenn die grossen Vermögen, die sehr hohen
Einkommen, das Kapital und die Unternehmer nichts
oder nur sehr wenig zur Finanzierung der Gesundheitsaus
gaben beitragen, erdrücken diesen das Budget
der lohnabhängigen Familien. Der Anstieg
der Krankenkassenprämien wird jedoch beim
Index der Konsumentenpreise nicht berücksichtigt,
derjeweils dem Teuerungsausgleich der Löhne
zu Grunde liegt. Nur schon die Erhöhung
der Krankenkassenprämien führt deshalb
dazu, dass das verfügbare Einkommen (was
nach den obligatorischen Ausgaben übrig
bleibt) Jahr für Jahr sinkt: - 0.5% im
Jahr 2002, - 0,5% im Jahr 2003, - 0,4% im Jahr
2004, - 0,2% im Jahr 2005, - 0,3% im Jahr 2006
(Bundesamt für Statistik).
Die Ablehnungsfront gegen die soziale Einheitskasse
beruht wesentlich auf der Tatsache, dass sie
dieses System ein bisschen in Frage stellt,
das allen grundlegenden Gedanken sozialer Gerechtigkeit
widerspricht. Denn die Initiative öffnet
den Weg zu Prämien, die von den finanziellen
Mitteln der Haushalte abhängig sind. Diesen
Grundsatz lehnen diejenigen ab, welche die Schweiz
wirklich regieren.
| Die
Reichen sind bei guter Gesundheit |
|
Die
Diskussion über eine soziale Einheitskasse
konzentriert sich auf das folgende Thema,
um die wichtigsten Fragen zu vermeiden:
„Wird der Mittelstand mehr Prämien
bezahlen?“ Lassen wir die Frage,
was überhaupt der „Mittelstand“
ist. Eine Führungskraft (oder jemand,
der sich als eine solche betrachtete)
einer Bank oder einer Versicherung, die
im Alter von 55 Jahren entlassen wurde,
könnte uns darüber etwas Interessanteres
erzählen als zahlreiche Soziologen;
von den Journalisten gar nicht zu sprechen.
Lassen wir also den „Mittelstand“
und kommen wir zur real existierenden
herrschenden Klasse. Sie verfügt
über grosses Kapital, investiert
an den Finanzmärkten und beteiligt
sich an Holdinggesellschaften, durch die
sie ganze Netzwerke von Unternehmen in
Industrie- und Dienstleistungsbereichen
kontrolliert. Vor einigen Jahrzehnten
hielten sich die Mitglieder dieser Klasse
diskret im Hintergrund. Heute treten sie
in Davos oder an den exklusiven Cocktailparties
in Zürich, Basel oder Genf öffentlich
in Erscheinung.
Ein Abbild dieser sozialen, wirtschaftlichen
und politischen Macht der herrschenden
Klasse lieferte die vergoldete Ausgabe
der Monatszeitschrift Bilanz im Dezember
2006. Die 300 reichsten in der Schweiz
wohnhaften Personen verfügten 2006
insgesamt über ein Vermögen
von 450 Milliarden Franken. Von 2005 auf
2006 ist dieses Vermögen um 55 Milliarden
gewachsen, das heisst so viel die die
gesamten Gesundheitskosten. Von diesen
300 teilen sich 118 Milliardäre den
grössten Teil des Kuchens auf. Es
wäre besser, darüber zu diskutieren,
anstatt die Zeitungen mit Spekulationen
über die zukünftigen Prämien
des Mittelsstands zu füllen, während
ein richtiges Prämienmodell für
die Einheitskasse gar nicht vorliegt.
Die eidgenössische Steuerverwaltung
hat eben erst ihre Statistiken für
2003 veröffentlicht. Der Ergebnis
ist unglaublich: 68,35% der Steuerpflichtigen
(mit weniger als 100'000 Franken Vermögen)
besass 5,57% des gesamten Vermögens.
Im Gegensatz dazu verfügten 0,14%
der Steuer¬pflichtigen mit einem (angegebenen!)
Vermögen von über 10 Millionen
über 19,73% des gesamten Vermögens.
Und 3,73% der Steuerpflichtigen mit einem
Vermögen von über 1 Million
besassen 54,11% des gesamten (angegebenen!)
Vermögen in der Schweiz. Diese Statistik
berücksichtigt allerdings nicht einmal
den tatsächlichen Wert von Immobilien
(die Immobilienpreise sind in den letzten
Jahren stark gestiegen).
|
|